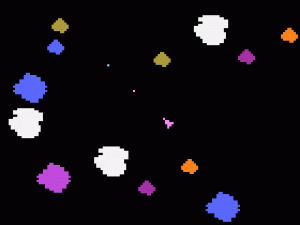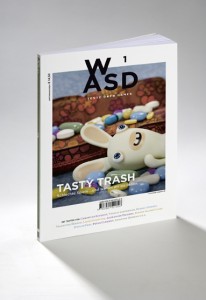Tips: Videospiele für Kinder und Jugendliche

So sieht es aus, wenn die Videospiele-Industrie Promo-Fotos macht: Drei Jungs müssen "Skylanders" spielen und sehr begeistert tun. Ganz so peinlich, wie dieses Foto nahelegt, ist das Spiel gar nicht.
Das Beste für den kleine Gamer
Videospiele für Kinder gehören zurzeit zu den erfolgreichsten. Leider gibt es in diesem Segment Großartiges neben großem Unsinn. Ein paar Tips zu Weihnachten (2012) – eine Übersicht für alle Spieler zwischen 4 und etwa 12.
Da können kulturkonservative Mahner sagen, was sie wollen: Videospiele stehen bei Kindern nun einmal ganz oben auf dem Wunschzettel. Einige bieten kluge Unterhaltung, andere sind einfach nur dumm. Hier ein paar Tipps, welche Titel gut sind – und von welchen man besser die Finger lässt.
Das wichtigste Kinderspiel des Jahres ist gleichzeitig auch das nervigste, zumindest für Eltern. “Skylanders“ ist eine Mischung aus Video-Action und Figurensammelei. Die Spieler stellt die rund sieben Zentimeter hohen Plastikmonstern auf ein Podest, das mit der Konsole verbunden ist und steuert dann ihr Abbild durch die digitale Welt.
Doch die fällt recht banal aus: Kleine fliegende Inseln, eine Art Mittelerde im Comic-Stil, werden von Monstern bedroht. Denn die “Balance, die es allen Wesen erlaubt, im Einklang zu leben”, ist gestört – so heißt es gleich am Anfang. Das war’s dann auch mit der pädagogisch wertvollen Botschaft. Der Rest ist Prügeln. Man schubst, boxt und knufft andere Wesen aus dem Weg. Der zweite, seit Oktober erhältliche Teil “Skylanders Giants” wiederholt das Muster ohne neue Ideen. Die Spielmechanik ist ohnehin Klassikern wie “Mario Galaxy” entliehen.
Dennoch ist das Spiel ein gerissenes Marketingkunstwerk. Die derzeit insgesamt 80 verschiedenen Figuren werden auf der ganzen Welt von Kindern getauscht und gesammelt. Nach einer Schätzung der Zeitschrift “Business Week” sind knapp 70 Millionen verkauft. Jedes Plastikmonster enthält einen sogenannten RFID-Chip, der die persönlichen Eigenschaften der Figur in das Spiel überträgt.
Das alles funktioniert prächtig. So können Kinder auch nur mit den Figuren spielen. Man kann mit ihnen sogar baden, ohne dass sie leiden. Auf die eine oder andere Art begeistert das Spiel also jeden zwischen drei und zehn Jahren. Und so ist “Skylanders” einer der größten Erfolge des Jahres, war in der ersten Jahreshälfte das Nummer-eins-Game weltweit.
Das hat viel ausgelöst. Die Spielebranche entdeckt gerade, dass das sehr junge Publikum oft am interessantesten ist. Etliche aufwendige Spiele für Kinder sind pünktlich zum Weihnachtsgeschäft erschienen.
Manche davon wirken ein wenig irre. Das “Wonderbook” dürfte davon das experimentellste sein. Der Spieler muss sich vor die Move-Kamera der Playstation setzen und ein buchartiges Objekt aufklappen. Der Bildschirm wird dann zum Spiegel, in dem man sich mit dem zum Leben erwachten Buch sieht. Aus den Seiten steigen Aufgaben und Szenen auf. Leider gibt es dafür bisher nur das lahme “Buch der Zaubersprüche“. Es hat die Lizenz, Begriffe aus der Harry-Potter-Welt zu benutzen, sieht zwei Minuten lang spektakulär aus – und hat die erzählerische Kraft eines lieblos gemachten Point-and-Click-Adventures.
Die derzeitige Technik-Mode ist damit umrissen: Besonders bei Kinderspielen geht es um neue Geräte, die einen einfachen und natürlichen Zugang bieten sollen. Das gilt auch für Nintendos neue Konsole WiiU. Das Besondere hier: Der Controller der Konsole besitzt einen eigenen Bildschirm. Das schönste Kinderspiel dafür ist “New Super Mario Bros. U”. Zwei können zusammen spielen und sich gegenseitig helfen. Etwa so: Einer lässt Mario auf dem großen Schirm über einen Abgrund rennen, der andere setzt auf dem kleine Touchscreen des Wii-U-Controllers schnell fliegende Felsen in die Luft, damit Mario immer neu abspringen kann.
So spektakulär das ist – einige Spiele brauchen keinen großen Karton, in dem ein obskures Peripheriegerät steckt, und überzeugen trotzdem. Warner etwa erzählt seit ein paar Jahren die großen Epen der Popkultur in einer animierten Lego-Welt nach. Indiana Jones, Star Wars und Batman werden so zu dem Kinderkram, der sie insgeheim immer schon sind. Nun ist “Der Herr der Ringe” zum digitalen Lego geworden – und erzählt Tolkien erfrischend neu. Da fliegt Legolas (!) auch mal plötzlich eine Banane an den Kopf. Ein humorvolles Actionspiel – in der oft bierernsten Games-Welt ein Segen.
Stehenlassen sollte man dagegen das Disney-Spiel “Epic Mickey 2″ - zu verwirrend und hyperkomplex. Noch elender scheitern die Spiele zu “Ralph reicht’s”. Der hübsche Animationsfilm hat Retrogames zum Thema, daraus hätte man viel machen können. Die Macher haben sich für ein sehr durchschnittliches Jump-and-Run entschieden.
Wer Empfehlungen sucht, kann sich auch die wenigen Auszeichnungen für Kinderspiele ansehen. Das führt derzeit wieder zu dem Tipp “Es war einmal ein Monster”. Das ist zwar schon ein Jahr alt, hat aber kürzlich beim “Tommi”, dem wichtigsten deutschen Preis für Kinder-Videospiele, zu Recht einen Sonderpreis erhalten. Mit dem Kinect-Sensor der Xbox, also frei im Raum, durch Wedeln, Hüpfen und andere Bewegungen, steuert man Wesen aus der Sesamstraße durch ein paar schöne Level, zu den Stimmen der Originalsprecher. Am Ende gibt es eine große Party bei Grobi.
Das ist das wohl einzige Spiel, das man auch mit kleinen Kindern wirklich spielen mag. Denn die häufig anzutreffende Altersfreigabe “ab null” ist natürlich nicht ernst zu nehmen. Ganz kleine Kinder brauchen keine Games. Selbst größere können auf sie gut verzichten, und auch dies Jahr ist ein Fußball wieder ein sehr brauchbares Geschenk. Andererseits gibt es aber keinen Grund, Spiele zu verteufeln oder gar dem kulturpessimistischen Psychiater Manfred Spitzer zu glauben, der ein gut gehendes Geschäft daraus gemacht hat, alles Digitale abzulehnen. Videospiele wecken Neugier und Enthusiasmus bei Kindern. Dinge, die wir doch angeblich so oft vermissen bei der Jugend von heute.
Wer darauf besteht, dass Spielen einen Nutzen haben sollte, dem sei zu “Rocksmith” geraten. Musikspiele sind eigentlich ein Trend von vorgestern – “Guitar Hero” erreichte vor fünf Jahren den Zenit seiner enormen Popularität. Man musste auf einer Plastikgitarre im richtigen Rhythmus einen von vier Köpfen drücken, das hatte mit Musizieren soviel zu tun wie Peer Steinbrück mit dem Sozialismus. Bei “Rocksmith” aber schließt man erstmals einfach eine echte E-Gitarre an Konsole oder PC an.
Die Optik des Spiels – bunte Quasi-Noten kommen auf den Spieler zu, man muss sie im richtigen Moment anschlagen – ist zwar schamlos von “Guitar Hero” geklaut. Dass man aber ein echtes Instrument lernen kann, ist neu und funktioniert erstaunlich gut. Die Spielkonsole ersetzt keinen echten Gitarrenunterricht, kommt ihm aber nah – und sie korrigiert auch noch um ein Uhr morgens, wenn man nur dann Zeit zum Üben hat.