Neues Magazin WASD: Schlechte Spiele sind gute Spiele
Schlechte Spiele sind gute Spiele
Von Thomas Lindemann
Enttäuschungen beim Spielen gehören dazu. Offenbar sogar von Anfang an. Im Jahr 1980 habe ich, gerade erst im Grundschulalter, die hunderttausend Punkte bei Asteroids geschafft. Eine wahrlich blödsinnige Leistung, die man in keinem Lebenslauf unterbringen kann. Aber ich gab alles dafür. Es hat wochenlanges Training auf meinem VCS 2600 gekostet, wenn man weit genug kam, wurde die Schwierigkeit von einem Level zu nächsten nicht mehr härter, man musste dann nur in einen Fluss reinkommen, schauen, reagieren, und auf die Zahl am oberen Bildschirmrand schielen. Bloß – nach 99950 kam – so ein Schock – wieder die Null. Es gab da gar nichts zu erreichen.
Asteroids ist damit noch kein schlechtes Spiel. Eigentlich im Gegenteil – wenn wir ganz ehrlich sind, würden die meisten von uns viele supermoderne Survival-Shooter und Action-Abenteuer jederzeit gegen es eintauschen. Aber Asteroids zeigt, wie das Enttäuschtwerden zur frühesten Spielerfahrung gehört. Gäbe es einen Sigmund Freud der Games-Theorie – die tiefe Enttäuschung, dass ein Spiel mir nicht gibt, was ich mir gewünscht hatte, wäre sein Ödipuskomplex.

So gehen Chancen dahin: Alma, die Horrorheldin aus der F.E.A.R.-Reihe, hätte eine großartige Figur werden können.
Schlechte Spiele sind gute Spiele. Dieser Satz meint zwei Dinge. Einerseits: Richtig mies sind oft die ganz großen Spiele, in die Millionen gesteckt werden und auf die hunderttausende Fans warten – und dann kommt ein Käse wie „F3AR“ dabei raus. Und andererseits, schlechte Spiele sind eine gute Sache. Denn von ihnen können wir so viel lernen. Manchmal mehr als von großartigen Spielen. Wir merken durch schlechte Spiele auch erst wieder, was wir uns eigentlich von Games wünschen – und das ist im Moment so wichtig wie nicht anderes. Der Games-Mainstream ist so festgefahren und gleichförmig, dass neue Vorstellungen her müssen, was überhaupt ein wunderbares Spiel sein könnte. Dabei, diese Visionen zu entwickeln, helfen schlechte Spiele.
Überhaupt, apropos FEAR: Das war schon irre, als man im zweiten Teil irgendwann in einer surrealen Fantasy-Landschaft der offensichtlich Schwangeren Alma gegenüberstand, diesem Geistwesen, dass den Spieler in all die Kämpfe warf und immer wieder in wilden Traumbildern die Ballereien unterbrach. Nur: Wenn sie ein Traumwesen aus der anderen Dimension ist, wieso komme ich dann weiter, indem ich auf sie schieße? So dümmlich war ja nicht einmal der 80er-Horrortrash im Stil von „Poltergeist“. Geistern kann man keine reinhauen, es sei denn man ist bei den Ghostbusters. Das gleiche Problem hatte Alan Wake. Tolle Atmosphäre, die erste echte Steven-King-artige Erfahrung in einem Spiel. Am Anfang. Und dann wiederholt sich alles immer nur, und man wundert sich irgendwann doch: Tauchen körperlose Schatten aus dem Jenseits oder was auf, knüppele ich sie einfach nieder? Das soll alles sein?
Die besten Spiele sind oft auch schlechte Spiele. Und in einzelnen Details ist sogar ein Großteil der Spiele schlecht. Wenn mir bei L.A. Noire der Hut vom Kopf fällt, warum kann ich ihn nicht wieder aufsetzen? Warum haben die Macher von Vampire Rain: Altered Species eine ziemlich hübsche beklemmende Welt erschaffen, tolle Musik eingekauft und das Spiel dann so absurd schwer gemacht, dass niemand daran Spaß hatte? Und, soll das eine Story sein in „Crysis“? Die Aliens kommen, die Nordkoreaner auch, alle schießen auf alle, man fliegt weg von der Insel und dann wieder zurück, und das wars. Zugegeben, das war jetzt arg verkürzt. Die hanebüchenen Details fehlen. Es bliebe auch mit ihnen eine Zumutung. Und das für ein Publikum, dass so komplex zeitlich verschachtelte Mehrpersonen-Geschichten wie Pulp Fiction verstanden und geliebt hat.
David Cage, der Macher der Spiele „Fahrenheit“ und „Heavy Rain“, sagte mir einmal im Interview: „Ich bin erwachsen geworden, ich habe Kinder, ich habe wenig Zeit. Was soll ich mit einem schweren Spiel, das mich frustriert?“ Nun haben wir uns alle vielleicht auch mit etwas zu viel Lob auf sein „Heavy Rain“ gestürzt damals – so gut, dass man es immer wieder einlegen möchte, ist es auch wieder nicht. Aber es war ein Anfang. Man hat gemerkt: Es geht doch auch anders!
„Es könnte auch anders sein“, der große und simple Satz des Systemtheoretikers Niklas Luhmann, ist der Kern jeder progressiven Kulturkritik. Man muss sich nur mal vorstellen, was es alles geben könnte – selbst wenn es niemand macht – und schon gibt es an der herrlich bunten Gameswelt unserer Millionenkonzerne manches zu bemängeln. Sie nutzen nämlich viel zu oft die Möglichkeiten nicht, die sie hätten – auch deswegen sind ihre Hits oft einfach schlechte Spiele, egal wie viele Millionen sie kaufen. Wer braucht denn ein Hellboy-Spiel, das genauso funktioniert wie alle Actionspiele, nur viel schlechter und ganz einfallslos – dafür hätte Guillermo del Toro sich nicht auf den weiten Weg von Hollywood zur deutschen Gamesmesse machen müssen. Und wer freut sich wirklich an den Muskelsoldaten aus Space Marines, wenn mit Duke Nuke Em Forever gleichzeitig die endgültige Parodie des Machismo im Spiel herauskommt?
Das führen einem die wenigen fantastischen und besonders ungewöhnlichen jedes Jahres vor Augen – verrückte Dinge wie Child of Eden oder Portal, die einfach mal alles anders machen und beweisen, dass so viel Großartiges denkbar ist. Aber genau das führen einem auch schlechte Spiele vor Augen. Spielt man sie, weiß man wieder, was man sich eigentlich von einem Game wünscht. Insofern: Schlechte Spiele sind gute Spiele.
Der Autor ist Kulturjournalist, lebt in Berlin und betreibt eine blogartige Artikelsammlung unter www.games-feuilleton.de. Geboren wurde er im selben Jahr wie das erste große Videospiel, Pong.
Dieser Artikel erschien zuerst in “WASD” (Nr. 1/Juni 2012), einem hervorragenden neuen Kulturmagazin für erwachsene Videospieler, entstanden unter Regie des Journalisten Christian Schiffer. Man kann das Heft bestellen unter wasd-magazin.de (und das ist auch zu empfehlen).
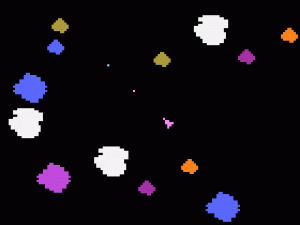
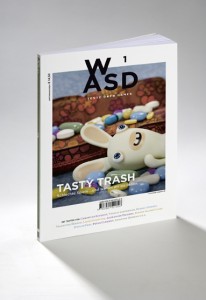
Keine Kommentare »
Noch keine Kommentare
RSS Feed für Kommentare zu diesem Artikel. TrackBack URI
Hinterlasse einen Kommentar